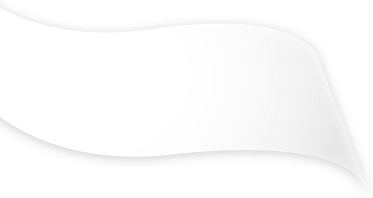Grashüpfer, Hummeln, Goldlaufkäfer, Schmetterlinge; dazu Wiesen-Salbei, Rot-Klee, Acker-Witwenblumen und der zottige Klappertopf – beim Blumenwiesenfest am 24. Juni in Bad Urach-Wittlingen drehte sich alles um die artenreiche Flora und Fauna auf der Schwäbischen Alb.

Die 22 teilnehmenden Naturfreunde, sieben davon Kinder, waren gut ausgerüstet mit Kescher und Becherlupen, aber auch natürlichen Hilfsmitteln wie einem guten Auge und spitzen Fingern auf dem Albvereins-Grundstück am Hartburren unterwegs. Unter der Leitung von Thomas Klingseis, Diplombiologe und Umweltpädagoge (faunistischer Teil) und Hanna Eberlein vom Regierungspräsidium Tübingen Referat 56 – Naturschutz und Landschaftspflege (botanischer Teil) machten sie sich ans Werk.
Vielfalt auf der Blumenwiese
Die Hitze der vergangenen Woche hatte die meisten Blüten schon zum Verblühen gebracht. Dennoch gab es noch einiges zu finden: Wiesen-Salbei, Wiesen-Margerite, Rot-Klee, Spitzwegerich, Acker-Witwenblumen und teilweise auch noch der zottige Klappertopf. Hanna Eberlein half beim Bestimmen der Pflanzen, von denen zum Teil nur noch die Fruchtstände zu sehen waren.
Eine kurze Frage muss an dieser Stelle sein: Woher der Klappertopf seinen Namen? Das konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den eigenen Ohren hören. Denn die Samenstände der abgeblühten Pflanze klappern im Wind. Gepflückt und geschüttelt lässt sich der Klappertopf als kleine Rassel verwenden.
Hausrezept gegen Mückenstiche
Aua, das juckt und schmerzt! Mückenstiche lassen sich bei derlei Unternehmen auf der Wiese leider nicht vermeiden. Hanna Eberlein hat hier eine pflanzliche Sofortmaßnahme parat. Bei Stichen aller Art hilft nämlich, Spitzwegerich zwischen den Fingern zu zerreiben und den Pflanzensaft auf den Stich zu streichen.

Insektenreiche Wiese
Auch verschiedenes kleines Getier fand sich auf der Wiese: Viele verschiedene Tiere gefunden: Schmetterlinge wie Ochsenauge und Bläuling, Grashüpfer, Grasnelkenwidderchen, Hummeln, Spinnen, Goldlaufkäfer und Feldgrillen, lateinisch Gryllus campestris. Vier männliche Grillen konnten die Kinder mit dem Käscher fangen. Thomas Klingseis hatte sogar Terrarien dabei, die die Kinder mit etwas Erde befüllten. Dort wurden die gefangenen Feldgrillenmännchen dann hineingesetzt, um sie genauer zu betrachten. Übrigens: Im Unterschied zu den Männchen haben die weiblichen Grillen eine nach hinten ragende Legeröhre.

Spannende Feldgrillen
Feldgrillen sind glänzend schwarz gefärbt. Fliegen können sie nicht. Sie leben in 10 bis 20 cm tiefen und zirka 2 cm breite Röhren in der Erde. Nur die Männchen können singen oder zirpen. Die Geräusche entstehen, sie ihre Vorderflügel aneinander reiben. Das ist etwa wie bei einer Geige, bei der der Bogen über die gespannten Saiten gezogen wird. Treffen beim Umherstreifen im Gelände zwei Männchen aufeinander, betasten sie sich mit den Fühlern und der Revierinhaber beginnt mit dem Rivalengesang, der aus einer langen Folge gleichartiger Schallsignale besteht. Das schreckt offensichtlich den Eindringlich ab. Wenn nicht, geht die Sache nicht gut aus. Heftige, gar tödliche Kämpfe sind die Folge – zu beobachten in dem Terrarium. Um Leben zu retten, wurden sie freigelassen, denn sonst wäre am Ende nur eine männliche Grille im Terrarium übriggeblieben.

Auch nächstes Jahr soll es wieder ein Blumenwiesenfest geben für alle, die in der Natur gerne mal etwas genauer hinschauen und Geschichten und Dramen in der Pflanzen- und Tierwelt live miterleben wollen. Wir laden rechtzeitig dazu ein.
Katharina Heine, Referentin Naturschutz beim Schwäbischen Albverein