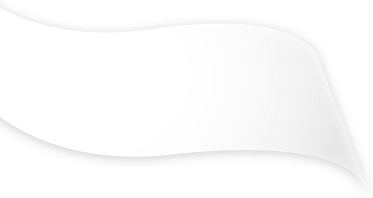Eigentlich darf man nicht auf eine Blumenwiese laufen und Sträuße pflücken oder Insekten sammeln. Aber zum Blumenwiesenfest im Juni in St. Johann-Ohnastetten hatte der Schwäbische Albverein auf sein eigenes Grundstück eingeladen. Der pachtende Landwirt hatte die Wiese extra stehen lassen, damit genügend Blumen, Gräser und Insekten zu finden sind.


Eifrig sammelten vor allem die teilnehmenden Kinder Anschauungsmaterial. Mit Fangnetzen, Keschern und Gläschen waren sie in der Wiese unterwegs, um Insekten zu finden. Dazu noch verschiedene Wiesenblumen. Doch wie heißen die Krabbeltiere und Pflanzen eigentlich?
Unter anderem gab es da den gelbgrünen Purzelkäfer, verschiedene Schmetterlinge wie den Bläuling oder das Ochsenauge, Grillen und Grashüpfer, Spinnen und Siebenpunkt-Marienkäfer.

Und zum heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer gab es gleich Spannendes zu erzählen. Der hat es nämlich mittlerweile ziemlich schwer, weil er vom asiatischen Marienkäfer verdrängt wird. Letzterer kommt heute nicht mehr nur in Japan und China vor, sondern auch in Nordamerika und Europa. Er kam unter anderem deshalb hierher, weil er wesentlich mehr Blattläuse am Tag verzehrt und deshalb seit den 1980er Jahren in großem Stil zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird.
Zum Vergleich: Unser heimischer, roter Siebenpunk-Marienkäfer vertilgt rund 50 Blattläuse am Tag, der asiatische, orange-farbene Kollege schafft locker das Fünffache. Auch beim Nachwuchszeugen liegt der asiatische Marienkäfer vor unserer heimischen Variante. Letzterer bekommt nämlich nur einmal im Jahr „Kinder“, beim asiatischen Marienkäfer wenigstens zwei neue Generationen, oftmals aber auch mehr, vorausgesetzt die Bedingungen stimmen.
Der Name Marienkäfer ist übrigens auf die Jungfrau Maria zurückzuführen. In ihrem Auftrag, so glaubte man früher, seien die kleinen Krabbeltiere in der Schädlingsvertilgung tätig. Zudem sollten sie vor Hexen und Unheil schützen. Bis heute sind sie ein Symbol für Glück.


Auch viele Pflanzen gab es auf der Wiese zu entdecken. War im vorigen Jahr aufgrund von Trockenheit schon fast alles verblüht, gab es heuer viele bunte Blüten –Wiesen-Salbei, Wiesen-Storchschnabel, Wiesen-Margerite, Wiesen-Bocksbart, zottiger Klappertopf, Ackerwitwenblume, Futter-Esparsette, Wiesen-Knäuelgras und noch einiges mehr. Umweltpädagoge Thomas Klingseis, der die Gruppe anleitete, empfahl als praktische Bestimmungshilfe für die Pflanzen die App Flora Incognita.
Leider werden artenreiche Blumenwiesen immer seltener. Grund dafür ist, dass sie häufig zu oft gemäht werden und sich die Pflanzen so nicht wirklich neu aussähen können. Oder sie verschwinden ganz, weil sie in Intensivgrünland zur Futterproduktion umgewandelt werden. Düngemittel und Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, setzen ihnen zu und zerstören die Artenvielfalt. Letztere ist auch durch invasive Arten bedroht, etwa das indische Springkraut und die kanadische Goldrute, die alles überwuchern. Dazu kommen der Klimawandel und die höheren Temperaturen, die den Lebensraum verändert. Es überwintern zum Beispiel immer mehr der aus dem Mittelmeerraum stammenden Falter bei uns. Auch setzen Extremwetterereignisse wie Dürren oder Starkregen den Blumenwiesen zu.
Umso wichtiger ist es, Blumenwiesen zu schützen und zu pflegen und die Flächen, die es noch gibt, zu erhalten. Dafür setzt sich der Schwäbische Albverein ein – unter anderem mit Bildungsveranstaltungen wie dem Blumenwiesenfest.
Vielen Dank an die Ortsgruppe Upfingen, die dieses Jahr beim Blumenwiesenfest mitgearbeitet hat, für Getränke gesorgt und zum gemütlichen Abschluss das Grillfeuer angeheizt hat.
Katharina Heine/Ute Dilg
Das Blumenwiesenfest 2025 findet Mainhardt statt. Wir laden rechtzeitig dazu ein.