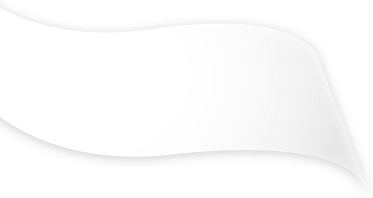Wanderungen in Gruppen und bunte Markierungen an Wanderwegen – damit verbinden die meisten Menschen den Schwäbischen Albverein. Doch der Verein ist weit mehr. Seit vielen Jahrzehnten setzt er sich für den Erhalt wertvoller Naturschutzgebiete und den Artenschutz ein.
Als einziger Naturschutzverband beschäftigt der Verein dafür einen hauptamtlichen Landschaftspflegetrupp. Der Leiter des Pflegetrupps, Jörg Dessecker, erläutert im Interview Geschichte und Aufgaben des Teams.

Wie muss man sich die Arbeit des Landschaftspflegetrupps vorstellen?
Jörg Dessecker: Wir kümmern uns um die Naturschutzflächen, die dem Schwäbischen Albverein gehören, und andere wertvolle Flächen. Außerdem unterstützen wir unsere Ortsgruppen bei ihrer Naturschutzarbeit. Das macht einen großen Teil von dem aus, was wir tun. Dazu kommen Pflegeverträge Diese laufen oft über mehrere Jahre.
Sie sprechen von „wertvollen Flächen“. Was verstehen Sie darunter?
Dessecker: Das können Wacholderheiden sein, Hecken oder Magerwiesen. Viele der Albvereinsflächen sind ja verpachtet an Schäfer und Landwirte. Wir werden da tätig, wo Landwirte mit größeren Maschinen nicht mehr tätig werden können, ohne größere Schäden anzurichten. . Wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen. Wir sind zum Beispiel bei den Landschaftspflegetagen der Gaue dabei oder binden Ehrenamtliche aus den Ortsgruppen in unsere Pflegeeinsätze mit ein.
Wie sieht eine typische Arbeitswoche aus?
Dessecker: Wenn wir größere Flächen zu pflegen haben, dann verbringen wir die Woche in der Regel vor Ort. Wir fahren also Montags hin und kommen erst am Freitagabend oder am Samstag wieder zurück nach Stuttgart. Übernachtet wird dann in unseren Wanderheimen, in Naturfreundehäusern oder Pensionen. Die Werkzeuge bringen wir mit dem Transporter mit. In manchen Gebieten – etwa im Schopflocher Moor – arbeiten wir auch mit einer Pferderückerin oder einem Pferderücker zusammen.
Das hört sich sehr intensiv an.
Dessecker: Das stimmt schon. Aber es gibt auch Zeiten, in denen es ruhiger ist. Etwa im Mai und Juni. Viel zu tun gibt es während der Vegetationsruhe von Oktober bis Februar. Da machen wir viele grobe Arbeiten, wie Gehölzpflege, Entbuschungsaktionen oder das Freischeiden von Wacholderheiden. Im Frühjahr geht es dann an die Obstbaumpflege, Trockenmauerbau und Besucherlenkungsmaßnahmen. Und im Sommer müssen Wiesen gemäht werden. Dazu kommen Besprechungen und Umweltbildungsmaßnahmen, z.B. Aktionen mit Schulklassen. Die Arbeit geht uns nicht aus.


Der Transporter des Pflegetrupps ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. 2021 muss er ersetzt werden. Dafür bitten wir um Spenden! Stichwort: Landschaftspflege. Oder Sie besuchen unsere Facebook-Spendenaktion.
Der Schwäbische Albverein leistet sich als einziger Naturschutzverband einen hauptamtlichen Pflegetrupp. Wie kam es dazu?
Dessecker: Ich bin quasi Mitarbeiter der ersten Stunde. 1991 habe ich als Zivildienstleistender angefangen und wurde danach sofort übernommen. Den Haupt- und Gaunaturschutzwarten war es ein großes Anliegen, für die Pflegearbeiten eine hauptamtliche Person zu haben, die damals die Zivildienstleistenden, heut die FÖJler anleiten und die Ortsgruppen bei ihren Aktionen beraten und unterstützen kann. Und dann hat das halt gepasst, dass da jemand war, der Interesse hatte, Begeisterung mitbrachte und sich mit der Landschaftspflege und in der Gegend auskannte.. Anfangs bestand der Pflegetrupp aus mir und zwei Zivis, meinem Privatauto und einem Hänger mit ein paar Werkzeugen. Mittlerweile sind wir zu fünft – zweiHauptamtliche, zwei FÖJler und ein Praktikant. Und wir haben einen etwas in die Jahre gekommenen Transporter sowie die nötigen Maschinen wie Motorsägen und Freischneider.
Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit?
Dessecker: Man ist draußen und hat mit der Natur zu tun. Das gefällt mir. Wenn im Frühjahr alles erwacht, sprießt und gedeiht, wenn alles blüht und die Vögel zwitschern, dann geht es mir gut. Mit unserer Arbeit erhalten Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Das ist mir wichtig.
Warum sind die typisch „schwäbischen“ Landschaften wie Wacholderheiden und Trockenrasen so wichtig für den Artenschutz?
Dessecker: Sie weisen eine unheimlich hohe Artenvielfalt auf. Auf Wacholderheiden oder Magerwiesen etwa wachsen zwischen 100 bis 150 verschiedene Pflanzenarten. Und auf jede Pflanzenart kommen 10 bis 15 Insektenarten, die darauf angewiesen sind. Deshalb sind diese Flächen so wichtig. Leider gibt es immer weniger davon. Sie sind eingeklemmt zwischen Wald und Intensivlandwirtschaft oder sie werden zerstückelt durch den Flächenfraß. Deshalb ist es so wichtig, die Flächen zu erhalten, die es noch gibt. Allerdings macht uns der Klimawandel mittlerweile schon sehr zu schaffen.

Inwiefern?
Dessecker: Die Artenvielfalt geht zurück. Es gibt fast keine Falter mehr, viele Blühpflanzen sind verschwunden. Die Flächen brennen im Sommer richtiggehend aus. Früher haben wir im Juli die erste Mahd gemacht. Danach kamen die Wiesen wieder zum Blühen. Das gibt es heute meist gar nicht mehr, weil es einfach zu heiß und zu trocken ist. Oft mähen wir deshalb auch nur noch einmal im Jahr und achten besonders darauf, bestimmte Areale mit Blühpflanzen auszusparen. Außerdem lassen wir auf von Schafen beweideten Wacholderheiden größere Gehölze stehen, damit die Tiere Schatten haben.
Gibt es eine Fläche, an der Sie besonders gerne arbeiten?
Dessecker: Bei Tuttlingen gibt es ein Waldbiotop, an dem der Frauenschuh gut wächst. Die Fläche war vor einigen Jahren noch sehr verwaldet. Unsere ehrenamtlichen Naturschutzwarte haben uns auf die Fläche aufmerksam gemacht. Wir haben dann große Fichten gefällt, die Gehölzsukzession zurückgedrängt und somit die Fläche geöffnet. Und wir erweitern das Areal immer mehr und pflegen es kontinuierlich. Es ist gigantisch zu sehen, wie viele Orchideen dort mittlerweile wieder wachsen. Ein weiteres Gebiet, das ich besonders mag, ist eine Fläche im Naturschutzgebiet Kochhartgraben und Ammertalhänge bei Tübingen. Vor 25 Jahren war da noch ein Schäfer mit seiner Herde unterwegs. Aber der Mann musste aus Altersgründen aufhören. Die Fläche ist daraufhin immer stärker zugewachsen. Wir haben dann mit viel ehrenamtlicher Unterstützung in mühevoller Handarbeit, mit Freischneider und Motorsäge die Trockenrasenflächen zurückgewonnen. Heute gibt es dort eine riesige Artenvielfalt. Zum Beispiel Küchenschellen im Frühjahr, Silberdisteln, Enziane und – ein besonderes Highlight – die Blauflügelige Ödlandschrecke.

Wie wichtig ist die ehrenamtliche Unterstützung für Ihre Arbeit?
Dessecker: Sehr wichtig! Ohne das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder gäbe es viele Naturschutzflächen gar nicht mehr. Den Ehrenamtlichen ist es auch hauptsächlich zu danken, dass es seit 1993 den hauptamtlichen Pflegetrupp gibt.
Weitere Infos: Landschafts- und Biotopflege des Schwäbischen Albvereins