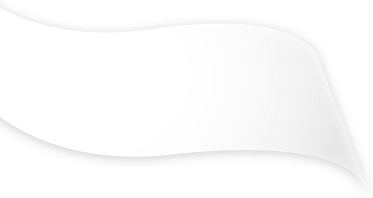Vom 25. bis 28. September findet im Naturschutzgebiet Füllmenbacher Hofberg bei Sternenfels-Diefenbach (Enzkreis) ein großer Landschaftspflegeeinsatz statt. Der Schwäbische Albverein ist dabei auf viele helfende Hände von freiwilligen Helferinnen und Helfern angewiesen. Ehrenamtliche können sich an einzelnen Tagen engagieren oder den ganzen Zeitraum mit dabei sein und dafür im Wanderheim Füllmenbacher Hof übernachten.
Artenreiche Trockenrasenflächen schützen
Der Füllmenbacher Hofberg besteht vorrangig aus artenreichen Trockenrasenflächen, die von Weinbergen und Waldflächen umrahmt werden. Das Gebiet ist ein optimaler Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tiere und Pflanzen, wie zum Beispiel das Purpur-Knabenkraut – eine heimische Orchideenart. Damit dieser südexponierte Trockenrasen in seiner einzigartigen Struktur erhalten bleibt ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Nur so kann eine Verbuschung verhindert werden. Der Landschaftspflegetrupp des Schwäbischen Albvereins sorgt gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern aus den Ortsgruppen seit über 30 Jahren für diese Pflege.
Ihr Einsatz für den Naturschutz auf dem Füllmenbacher Hofberg
Der Pflegetrupp mäht vor ab die Flächen und schneidet zugewucherte Areale aus. Die Aufgabe der Freiwilligen ist dann, das angehäufte Schnitt- und Mähgut mit Rechen und Heugabeln von den an den Fuß des Berghangs zu schaffen, wo es von einem Landwirt zur Kompostierung abgeholt wird.
Neben dem aktiven Einsatz für den Naturschutz, erfahren die Ehrenamtlichen mehr über die Bedeutung der Landschaftspflege zum Erhalt artenreicher Kulturlandschaften. Zusätzlich bieten wir eine Exkursion durch das Naturschutzgebiet an, bei der die Teilnehmenden mehr über die Flora und Fauna vor Ort und die Geschichte des Biotops erfahren.
Wann, wo und wie?
- Arbeitseinsatz von Mittwoch bis Samstag, 25. bis 28. September
- Arbeitszeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, kann je nach Wetter abweichen, Ende am Samstag gegen 15 Uhr.
- Anzahl der Teilnehmenden: 10 Personen für den gesamten Zeitraum. Es besteht die Möglichkeit, auch an einzelnen Tagen mitzuarbeiten.
- Mindestalter für die Teilnahme: 18 Jahre
Unsere Leistungen:
- Unterkunft in unserem Wanderheim Füllmenbacher Hof
- Übernachtung in Gruppenräumen, Vollverpflegung (Mithilfe bei der Küchenarbeit erwünscht)
- eine naturkundliche Führung
- Naturgenuss und eine befriedigende Arbeit im Freien bei der Landschaftspflege
Mitbringen:
Feste Schuhe und Arbeitskleidung/Kleidung
Handschuhe und Arbeitsmaterial (Rechen, Heugabeln etc.) werden gestellt
Kosten und Anreise:
Der Schwäbische Albverein übernimmt alle Kosten für Übernachtung und Mahlzeiten. Die Teilnehmenden kümmern sich selbst um ihre Anreise.
Wir freuen uns über viele Teilnehmende.
Weiterführende Infos und Anmeldung:
Referat Naturschutz
Naturschutzreferentin Katharina Heine
Telefon: 0711 22585-34 (Mo, Fr, ganztägig)
naturschutz@schwaebischer-albverein.de