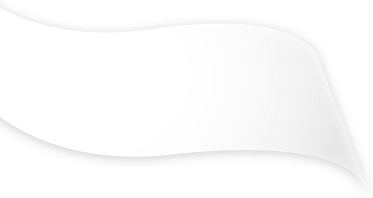Umgestürzte Bäume, starke dürre Äste am Boden und lichte Baumkronen: Dem Wald geht es nicht gut. Nach dem sauren Regen in den 1980ern macht nun der Klimawandel den Wäldern in Baden-Württemberg zu schaffen. Försterin und Gaunaturschutzwartin des Albvereins, Waltraud Leinen, dazu im Interview.
Wie geht es den Wäldern in Baden-Württemberg?
Nicht gut. Nach zwei Trockenjahren in Folge ist der Wald geschwächt. Die Bäume sind auf tiefe Wasserressourcen angewiesen. Aber das Grundwasser ist nach den heißen und trockenen Sommer einfach sehr niedrig. Schädlingsbefall ist ein Problem. Und an bestimmten Bäumen gibt es Verbrennungsschäden aufgrund der beiden extrem heißen Wochen im Sommer 2019. Es kommt also einiges zusammen.
Welche Baumarten sind besonders betroffen?
Die Fichte. Sie leidet sehr unter dem Borkenkäfer. Dieses Jahr ist er schon seit Ostern in großer Anzahl unterwegs, weil es so warm war und weil er sich durch die Hitze in den letzten beiden Jahren so gut vermehren konnte. Das setzt den Fichten sehr zu. Viele Bäume sind vorgeschädigt. Bei den Laubbäumen ist es die Buche, die leidet. Wir hatten ja gehofft, dass sie als einheimische und angepasste Baumart gut durch die heißen Sommer kommt. Aber auch bei ihr haben wir im Herbst 2019 extreme Schäden vor allem an den Kronen festgestellt. Die verbrennen unter der starken Sonnenstrahlung. In der Folge setzt sich ein Pilz rein und die Äste sterben langsam ab. Das macht uns wirklich Sorgen.
Gibt es regionale Unterschiede?
Nicht wirklich. Selbst im Schwarzwald, der normalerweise recht feucht ist, war es in den vergangenen Jahren viel zu trocken. Ostdeutschland hat es allerdings noch viel übler getroffen als uns. Da sterben ganze Wälder ab. Das hatten wir in dem Ausmaß bisher hier noch nicht.
Wie kann man als Laie die Schäden erkennen? Denn momentan sieht alles grün und schön aus.
Das ist in der Tat sehr schwierig. Gerade im Sommer sieht man ja nicht in die Kronen, wo oft sehr starke Äste abgestorben sind. Bei starkem Wind können die herunterfallen und Menschen gefährden. Im Winter erkennt man Schäden noch schlechter. In öffentlichen Wäldern, die von uns Förstern betreut werden, versuchen wir, möglichst alle Bäume, die eine Gefahr darstellen zu fällen. Aber wir können nicht überall gleichzeitig sein.
Was raten Sie Wanderern und Radfahrern?
Wenn ein Sturm oder Orkanböen angesagt sind, vorrangig im Winter, dann ist es im Wald gefährlich. Da muss man wirklich aufpassen. Das gilt vor allem für ältere Wälder, weil da viel runterbrechen kann. Im Sommer sind Sommergewitter gefährlich. Die kann man oft nicht so vorhersehen und das ist das Problem. Wenn Sie also in ein Gewitter kommen, dann nicht unter alten Bäumen Schutz suchen. Lieber irgendwo hingehen, wo die Bäume kleiner und niedriger sind. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ein ganzer Baum umfällt. Aber auch morsche Kronenteile und dürre Äste sind höchst gefährlich und auch faktisch vorher nicht sichtbar.
Was müsste die nächsten Jahre passieren, damit der Wald sich erholen kann?
Mehr Regen und moderate Sommertemperaturen. Aber die extremen Jahre häufen sich. Das ist ein Fakt. Von forstwirtschaftlicher Seite arbeiten wir seit dem Sturm Wiebke Anfang der 1990er Jahren an einem Waldumbau. Damals sind viele Fichten entwurzelt worden, weil sie mit ihren flachen Wurzeln nicht sturmstabil sind. Aber jede Veränderung im Wald dauert seine Zeit. Bäume wachsen eben langsam.
Wie muss man sich diesen „Umbau“ vorstellen?
Wir setzen bei der Aufforstung auf eine gute Durchmischung im Wald. Ein gesunder Mischwald hält Klimaveränderungen am besten aus. Das ist das eine. Zum anderen müssen wir aber auch den Waldbestand, der da ist schützen, indem wir zum Beispiel den Borkenkäfer im Zaum halten. Das ist im Sommer oft ein Wettlauf mit der Zeit. Leider haben wir dafür oft nicht genug Personal. Wir bräuchten dringend mehr Förster und Waldarbeiter – sowohl für die Aufforstung als auch für die Überwachung und Eindämmung von Schädlingen.
Werden denn schon Baumarten zugemischt, die hier nicht heimisch sind?
Ja. Die Douglasie etwa. Sie stammt eigentlich aus Nordamerika und hat sich in trockenen Sommern bewährt. Sie wurde allerdings schon vor gut hundert Jahren hier eingeführt, ist also nicht mehr ganz neu. Bei Laubholzbaumarten ist man noch nicht so weit. Die forstwirtschaftliche Versuchsanstalt sucht hier nach Lösungen. Aber das ist nicht so einfach. So ein Baum muss im Sommer Trockenheit aushalten, im Winter aber viel Feuchte. Also einfach Palmen pflanzen, weil es wärmer wird, funktioniert nicht. Momentan pflanzen wir vor allem da einheimische Eichen nach, wo Buchen Probleme haben. Eichen halten die Hitze und die Trockenheit bisher ganz gut aus.
Was kann der Schwäbische Albverein für den Wald tun?
Um die Klimaerwärmung zu stoppen und den Wald zu erhalten, ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Der Schwäbische Albverein und seine Mitglieder können vor allem informieren, durch waldpädagogische Maßnahmen ein Bewusstsein für den Klima- und Naturschutz schaffen und die Forstwirtschaft kritisch begleiten.
Waltraud Leinen ist Försterin und leitet im Landkreis Schwäbisch-Hall das Forstrevier Spielbach des Forstbezirks Tauberfranken. Im Schwäbischen Albverein ist sie als Naturschutzwartin im Burgberg-Tauber-Gau aktiv.
Das Interview führte Ute Dilg.
Weitere Informationen: