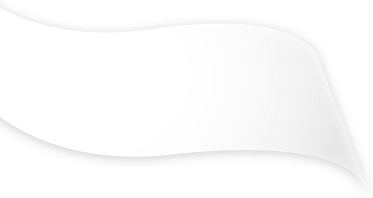Die EU-Richtlinie zur Wiederherstellung der Natur steht im Mittelpunkt des diesjährigen „Zukunftsforums Naturschutz“ des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg (LNV). Der Schwäbische Albverein gehört zu den Gründungsmitgliedern des Verbands.
Auf der Tagung des Landnaturschutzverbands Baden-Württemberg (LNV) referieren Fachleute aus Wissenschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Verwaltung. Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt an der Abschlussdiskussion teil. Eingeladen sind alle Interessierten.
Zukunftsforum Naturschutz 2025: Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur – ambitionierte Ziele, praktische Fragen und politische Gefahren
Termin: Samstag, 22. November 2025, 9:30 bis 17 Uhr
Ort: Evangelisches Bildungszentrum Hospitalhof, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart
Tagungsbeitrag: 50 Euro
Programm und Anmeldung: unter www.lnv-bw.de/zukunftsforum2025. Anmeldung bis zum 14. November über die Website oder per E-Mail an info@lnv-bw.de
Hintergrundinfos zur EU-Richtlinie und zum Zukunftsforum:
Die Europäische Union hat 2024 die Wiederherstellungsverordnung (WVO) beschlossen, das Nature Restoration Law. Sie gilt in allen EU-Ländern direkt wie ein Gesetz und schreibt vor, dass 30 Prozent der Land- und Binnengewässerflächen unter Schutz zu stellen sind – auch um bestehende europäische und globale Verpflichtungen einzulösen. Die nationalen Wiederherstellungspläne sollen der EU bis September 2026 vorliegen. Die Zeit drängt.
Die LNV-Tagung stellt verschiedene Blickwinkel vor, beleuchtet Hintergründe und sammelt Vorschläge zur Umsetzung. Unter anderem referieren Vertreter der Verwaltung über den Sachstand sowie die Planungen in Baden-Württemberg. Die Sicht der Landwirtschaft bringt Bernhard Bolkart ein, der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Der Landschaftsökologe und Vorsitzende des Vereins Naturnahe Weidelandschaften Dr. Alois Kapfer hinterfragt in seinem Vortrag die derzeitige Naturschutzpraxis grundsätzlich.
Den Abschluss bildet ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Das vollständige Programm ist unter www.lnv-bw.de/zukunftsforum2025 einsehbar.
Veranstalter des Zukunftsforums Naturschutz sind der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg als Dachverband der Natur- und Umweltschutzverbände im Südwesten so-wie das Evangelische Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart.