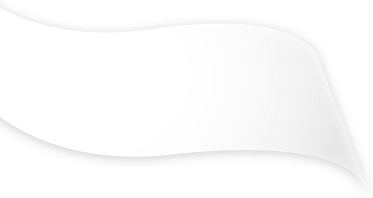Die langen Hitze- und Dürreperioden in den vergangenen Jahren haben den Wäldern in Baden-Württemberg stark zugesetzt, berichtet Försterin und Gaunaturschutzwartin des Schwäbischen Albvereins, Waltraud Leinen, im Interview zum Tag des Waldes am 21. März. Ein vergleichsweise feuchtes Jahr 2023 hat daran nicht viel geändert. Der Forst arbeitet an Strategien, den Wald widerstandsfähiger zu machen.
Frau Leinen, wie ist der Zustand des Waldes derzeit?
Leider schlecht, auch wenn 2023 ein überdurchschnittlich nasses Jahr war. Aber Juni und Juli waren zu warm und sehr trocken. Das hat die Bäume gestresst. Es reichen schon sechs Wochen ohne Regen aus, dass auch tief wurzelnden Bäumen das Wasser ausgeht. Und solch lange Trockenzeiten haben wir mittlerweile jedes Jahr. Die Wälder haben einfach keine Zeit mehr, sich wirklich zu regenerieren. Sie sind im Dauerstress.
Wie wirkt sich dieser Stress konkret aus?
In den langen Trockenphasen sterben viele Äste ab. Außerdem sind die Bäume anfälliger für Schädlinge, also für Insekten oder Pilze. Diese nutzen die Schwächung der Bäume aus. Selbst die Buche, die ziemlich robust ist, zeigt großflächig Schäden. Da leuchten alle Alarmknöpfe.
Sind diese Schäden dem Klimawandel zuzuordnen? 2023 haben wir ja zum ersten Mal die 1,5 Grad-Marke überschritten.
Man muss das differenzieren. Ein Durchschnittswert, wie die 1,5 Grad, sagt über das Wohlbefinden einer Pflanze prinzipiell erst einmal nichts aus. Es wird im Schnitt wärmer, das stimmt. Aber das ist isoliert betrachtet nicht unbedingt ein Problem. Das Problem für den Wald und für unsere Natur generell sind langhaltende Wetterphasen. Und werden im Zuge des Klimawandels häufiger. Wir haben monatelange Schönwetterphasen mit teilweise sehr hohen Temperaturen, dann wieder Regenphasen über mehrere Monate. Dazu gibt es mehr Stürme – das tut der Vegetation nicht gut. Faktisch sind deshalb mittlerweile alle Bäume vom Klimawandel betroffen. Die Schäden sind enorm.
Artenreicher Mischwald ist der beste Schutz gegen den Klimawandel. Das ist mittlerweile gut belegt. Wie reagiert die Forstwirtschaft auf diese Erkenntnisse?
Es ist richtig, dass eine Mischung der Baumarten eine größere Widerstandskraft hat, als eine Monokultur. Je mehr Arten, desto stabiler ist ein Ökosystem. Die verschiedenen Arten stützen sich dann gegenseitig und schaffen einen Ausgleich. Allerdings gibt es bei uns auch natürliche Monokulturen wie den Buchenwald. An guten Standorten verdrängt die Buche andere Baumarten. Aber sie kommt auch als Mischbaumart vor auf für sie nicht so optimalen Böden. Wir versuchen jetzt, dort, wo die Buche Probleme bekommt, den Wald zu diversifizieren. Etwa mit der Eiche oder der Elsbeere. Das geht nur durch Pflanzung. Grundsätzlich muss man sagen, dass der europäische Wald generell artenarm ist. Das liegt an der Eiszeit. Im tropischen Wald oder auch in amerikanischen Wäldern ist die Artenvielfalt viel größer – auch auf den gleichen Breitengraden. Das bedeutet, dass uns gar nicht so viele Baumarten für eine Durchmischung zur Verfügung stehen.
Sind Bäume aus anderen Erdgegenden eine Lösung? Man könnte widerstandsfähige Arten von dort bei uns anpflanzen.
Die forstlichen Versuchsanstalten experimentieren derzeit mit Baumarten vom Balkan und aus Zentralasien – also Arten, die an kontinentales Klima gewöhnt und von Natur aus heißen Sommern und Trockenheit ausgesetzt sind. Solche Versuche sind aber sehr langwierig, 40 Jahre und mehr. Bäume wachsen halt langsam. Es gibt viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Wie wirken sich fremde Arten auf unser Ökosystem aus? Wie kommen sie mit den Böden hier klar? Wie mit hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer? Und was macht das mit den heimischen Arten, wenn man eine fremde Art einführt? Das ist alles nicht so einfach. Wir tasten uns da heran.
«Unsere Wälder verändern sich durch den Klimawandel. Es kann gut sein, dass sie in Zukunft jünger und lichter sein werden.» (Waltraud Leinen)
Welche Strategien zur Klimaanpassung stehen denn sonst noch zur Verfügung?
Wir nutzen einmal die natürliche Verjüngung. Und wir pflanzen punktuell verschiedene Baumarten, wo eine natürliche Durchmischung und Verjüngung durch Aussaat nicht zu erreichen ist. Dafür nutzen wir zum Beispiel den Spitzahorn. Der ist relativ hitze- und trockenresistent. Im Bereich der Nadelhölzer greifen wir auf Bäume mit tiefen Wurzeln zurück, etwa die Weißtanne oder auch die Douglasie. Sie ist zwar auch keine heimische Art, aber sie ist immerhin schon gute hundert Jahre hier, so dass wir bereits Erfahrungen mit ihr haben. Von Fichtenschonungen unter 500 Höhenmetern müssen wir uns verabschieden. Die Bäume sterben in diesen Breiten einfach ab, weil es zu trocken ist. Vielleicht müssten wir aber auch tatsächlich mutiger in Versuche mit anderen Arten gehen. Denn so wie es momentan aussieht, können wir nicht abwarten, bis sich unsere Wälder natürlich umbauen.
Wie verändert sich die Arbeit im Forst in Zeiten des Klimawandels?
Wir Försterinnen und Förster haben viel mehr Arbeit als früher. Wir müssen mehr Kontrollen durchführen, weil es viel mehr geschädigte Bäume gibt. Der Wald ist groß. Da stehen wir echt unter Druck. Außerdem müssen wir wesentlich mehr pflanzen. In meinem Revier sterben gerade sehr viele Eschen durch eine Pilzkrankheit. Das macht mir Sorgen und bereitet mir viel Arbeit.
Der Wald ist Erholungsraum für viele Menschen. Wir kennen ihn als dicht und grün und friedlich. Nachdem was Sie erzählen, verändern sich die Wälder aber gerade sehr. Werden wir künftig noch Wälder haben, wie wir sie jetzt kennen?
Unsere Landschaft verändert sich. Schauen Sie mal ins Sauerland oder in den Harz. Da gibt es mittlerweile Flächen, die komplett entwaldet sind, weil die Fichten alle abgestorben sind. Wir in Baden-Württemberg haben Glück, dass wir sehr schöne und sehr gemischte Wälder haben. Aber auch bei uns sterben Bäume teils flächig ab. Ich denke, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr so viele alte Bäume geben wird, vor allem im Wirtschaftswald. Ein junger Baum hält einfach mehr aus. Allerdings sind alte Wälder sehr viel artenreicher. Deshalb ist das nicht unbedingt eine gute Aussicht für den Naturschutz.
Eine andere Strategie können wir uns aus dem Mittelmehrraum abschauen. Dort stehen die Bäume viel weiter auseinander, damit sie sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Vielleicht werden wir das übernehmen müssen. Dadurch wird unser Wald lichter werden.
Durch den Klimawandel gibt es mehr Stürme bei uns. Äste werden abgerissen, Bäume stürzen um. Wie sicher ist es dauerhaft noch in unseren Wäldern?
Bei Starkwind ist es im Wald nicht sicher! Das kann ich nicht oft genug sagen. Viele alte Bäume haben im Kronenbereich dicke, abgestorbene und zum Teil morsche Äste. Wenn da einer runterfällt, kann das lebensgefährlich sein.
Astbruch im Wald gilt als „waldtypische Gefahr“. Was bedeutet das genau für Erholungssuchende?
Das bedeutet, dass sie sich auf eigene Gefahr im Wald aufhalten. Wir Förster sind nicht verpflichtet und auch nicht in der Lage, an Waldwegen alle dürren Äste von den Bäumen zu entfernen. Das ist anders an öffentlichen Straßen oder in städtischen Parks. Da werden die Bäume genau kontrolliert. Wenn Sie in den Wald gehen, dann müssen Sie mit „waldtypischen Gefahren“ rechnen, also damit, dass auch einmal ein Ast herunterfällt. Leider wissen das viele Menschen nicht. Ich sehe es als eine der Aufgaben der Wandervereine an, auch auf diese Gefahren hinzuweisen.