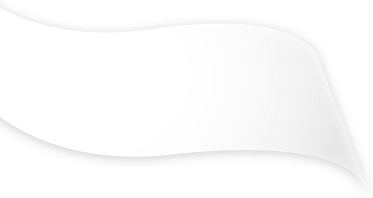Der Schwäbische Albvereins hat einen sehenswerten Beitrag zur Remstal Gartenschau 2019 geschaffen. Näheres gibt es nachzulesen hier: Faltblatt Heckenprojekt
Nun aber auf zur Remsmündung nach Neckarrems!
Remseck ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar – die Stadtbahn U 14 fährt vom Stuttgarter Stadtzentrum direkt an die Remsmündung, Endhaltestelle Neckargröningen. Unsere zwei, besser drei oder vier Stunden lange Wanderung führt über zwei überdachte Fußgängerbrücken und durch den Ortskern Neckarrems remsaufwärts – allerdings zwangsläufig mit einem kleinen Umweg: Die Mühlstraße ist eine Sackgasse, vor der Mühle links ein paar Schritte bergaufwärts erreicht man die Mühläckerstraße, und diese geht’s dann wieder bergabwärts zur Rems.
Schnell ist der Ortsrand und der bis in die 1980er Jahre in Betrieb befindliche alte Steinbruch erreicht; die hohen Muschelkalkwände bieten für Menschen unerreichbare Brutplätze für seltene Vogelarten wie Wanderfalke und Kolkrabe. Also Fernglas parat halten! Erläuterungstafeln der Naturschutzverwaltung am Wegesrand weisen auf die naturkundlichen Besonderheiten des unteren Remstales hin.
Dem Remsufer entlang erreicht man auf dem Fahrrad- und Wanderweg nach etwa 500 Metern das Heckenpflegeprojekt des Schwäbischen Albvereins, die ersten Informationstafeln sind unübersehbar. Nach vierjährigen Vorbereitungen konnte Anfang Mai 2019 ein von anderen Gartenschauprojekten abweichendes Anschauungsobjekt eingeweiht werden. Den links abzweigenden steilen „Schlittenweg“ sollte man 400 Meter gehen; acht Informationstafeln erklären kurz und bündig, um was es geht; QR-Codes vermitteln Wissenswertes und lassen auch den einen oder anderen Heckenvogel aus dem Smartphon-Lautsprecher ein Liedchen trällern.
Alte Karten von 1830 zeigen das untere Remstal durchgehend als Weinberglandschaft, nur an wenigen Stellen gab es Äcker und Wiesen, und örtlich war der Boden offenbar so karg, dass „Schafweide“ als die extensivste Form der Landnutzung verzeichnet ist. Diese früheren Weiden sind in den letzten Jahrzehnten, nachdem sie seit etwa 1930 nicht mehr beweidet worden sind, zu einer Heckenlandschaft geworden. Stellenweise sind die Hecken geradezu zu Wäldern geworden und bieten den typischen Heckenbewohnern wie Amsel, Drossel, Fink und Star, aber auch Feldhase, Igel und Wiesel keinen Lebensraum mehr. Rechts und links des so genannten „Schlittenweges“ wurden in den vergangenen vier Jahren abschnittsweise die Hecken verjüngt – „auf den Stock gesetzt“, wie Fachleute den Vorgang heißen, dass man Sträucher absägt und neu austreiben lässt.
Es präsentiert sich nun ein abwechslungsreiches Bild – geradezu ein Ideal-Lebensraum für die oben genannten Arten. Die mosaikartige, kleinteilige Vorgehensweise hat dafür gesorgt, dass das Landschaftsbild nicht gelitten hat, sondern noch abwechslungsreicher geworden ist. Dass Heckenpflege mit Eingriffen in den Baum- und Strauchbestand verbunden ist, steht außer Zweifel – das Endergebnis allerdings lässt erkennen, dass verjüngte Sträucher wesentlich wüchsiger sind und sowohl bessere Nistmöglichkeiten als auch bessere Nahrungsquellen und vor Feinden sichere Rückzugsräume bieten.
„Die einen können lernen, wie man richtig Hecken pflegt, andere werden feststellen, dass nicht jeder Eingriff in eine Feldhecke ein Frevel ist.“ Mit diesen Worten erläutert Reinhard Wolf den Sinn und Zweck des mehrjährigen Heckenpflegeprojekts.
Bei den Pflegemaßnahmen kam ein Relikt aus längst vergangener Weinbauzeit zutage: ein in eine Böschung eingelassenes Gewölbe aus Steinquadern, gebaut sozusagen für die Ewigkeit. Der Wengertschütz hauste hier während der Traubenreife, ein Ehrfurcht einflößender Gemeindebediensteter, der dafür sorgen musste, dass gleich morgens in der Dämmerung mit der Rätsche und der Schreckschusspistole hungrige Stare vertrieben wurden und sich auch sonst tagsüber keine Traubendiebe in den Weinbergen zu schaffen machten. Das steinerne Häuschen wurde nun wieder zugänglich gemacht und hergerichtet; zwei Sitzgruppen laden zum Verweilen ein. Vermutlich war hier einst bei der Traubenernte reges Leben und ein kleiner Festplatz. Eine neue steinerne Ruhebank – im Schwäbischen „Gruhe“ genannt –, Replik einer in Resten noch vorgefundenen alten Bank, ziert den Zugang zum Wengertschützenunterstand. Die Vorbeikommenden konnten da früher auf dem hohen Stein ihre schwere Kopf- oder Rückenlast abstellen und auf der niederen Bank ein wenig ausruhen – schwäbisch „ausgruebe“, daher der Begriff „Gruhe“.
Möglich gemacht hat das Vorhaben des Schwäbischen Albvereins die Umweltstiftung Stuttgarter Hofbräu, die mit einem namhaften Betrag die Informationstafeln gesponsert hat. Auch der Stadtverwaltung Remseck, vor allem den Mitarbeitern der Technischen Dienste, gebührt großer Dank für die tatkräftige Umsetzung der Pflegemaßnahmen. Die Gruhe wurde vom Steinmetzbetrieb Hans und Peter Dietl, Steinheim/Murr, gefertigt und von der Stiftung Franz und Rosina Greiling sowie dem Königin Katharina-Fonds finanziert.
Die Remstalwanderung kann man auf einen ganzen Tag ausdehnen – es gibt vieles zu entdecken. Einschränkend muss man sagen, dass an schönen Sommerwochenenden der Fahrradverkehr für Wanderer lästig sein kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten: werktags wandern oder auch auf’s Fahrrad sitzen!
Ob wir nun bis Waiblingen und dort durch die Stadt zum S-Bahnhof marschieren (insgesamt 13 km) oder aber irgendwo kehrt machen und zum Ausgangspunkt zurückkehren, ist eigentlich egal; das Tal ist so abwechslungsreich, dass der Rückweg genauso interessant ist wie der Hinweg.
Text: Reinhard Wolf